 Clark Ashton Smith ist der nicht ganz vergessene Zeitgenosse von H. P. Lovecraft und Robert E. Howard aus den Zeiten der Pulp-Magazine wie Weird Tales. Sein literarisches Werk – im Laufe des letzten Jahrzehnts erstmals als sechsbändige Sammelausgabe auf Deutsch erschienen – besteht neben seiner Lyrik vor allem aus Kurzgeschichten, die alle Spielarten der Phantastik durchziehen und doch kaum irgendeiner anderen Strömung vor oder nach ihm ähneln. „Das Labyrinth des Maal Dweb“ ist hierbei der dritte Band nach Die Stadt der Singenden Flamme und „Die Grabgewölbe von Yoh-Vombis“ und enthält insgesamt 16 Geschichten. Am Ende werden diese ergänzt durch einen editorischen Kommentar zu einer jeden, der vor allem auf die Publikationsgeschichte eingeht und oft auch zugehörige Quellen aus Smiths umfangreichem Briefverkehr erschließt.
Clark Ashton Smith ist der nicht ganz vergessene Zeitgenosse von H. P. Lovecraft und Robert E. Howard aus den Zeiten der Pulp-Magazine wie Weird Tales. Sein literarisches Werk – im Laufe des letzten Jahrzehnts erstmals als sechsbändige Sammelausgabe auf Deutsch erschienen – besteht neben seiner Lyrik vor allem aus Kurzgeschichten, die alle Spielarten der Phantastik durchziehen und doch kaum irgendeiner anderen Strömung vor oder nach ihm ähneln. „Das Labyrinth des Maal Dweb“ ist hierbei der dritte Band nach Die Stadt der Singenden Flamme und „Die Grabgewölbe von Yoh-Vombis“ und enthält insgesamt 16 Geschichten. Am Ende werden diese ergänzt durch einen editorischen Kommentar zu einer jeden, der vor allem auf die Publikationsgeschichte eingeht und oft auch zugehörige Quellen aus Smiths umfangreichem Briefverkehr erschließt.
Vielleicht mehr noch als die anderen zeigt diese Sammlung Hoch und Tief von Smiths Schaffen: Obgleich mit überquellender Fantasie und sprachlichem Ausdrucksvermögen gesegnet, war dieser doch zeitlebens gezwungen, sich immer wieder den plakativeren und weniger literarischen Interessen der Leser und vor allem Herausgeber der zeitgenössischen Magazine anzupassen. Davon zeugen etwa die Geschichten „Der Flirt“ und „Etwas Neues“ – sehr kurze Texte mit eher plattem, schlüpfrigen Inhalt, die der Autor selbst zeitlebens als Mist bezeichnete. Auch sonst sind Stil und Qualität der Texte relativ wechselhaft.
Mit den meisten seiner Geschichten bewegte sich Clark Ashton Smith an der Grenze zwischen früher Science-Fiction und Fantasy, manchmal auch Horror, freilich ohne sich damit in klar umgrenzte Genres wie die klassische Gothic Fiction oder Mittelalter-Fantasy zu stellen. Gerne siedelte er seine Erzählungen auf fremden Planeten und Dimensionen an, den fernsten Abgründen von Zeit und Raum, in denen sich dann letztlich alles verbergen kann. So reist ein Protagonist in „Ein Abenteuer in der Zukunft“ Jahrtausende in der Zeit nach vorne, nur um dort eine utopische Menschheit kennen zu lernen, die sich gleichsam in einer Krise mit den Bewohnern des Mars und der Venus befindet. Gar nicht unähnlich ist „Invasion von der Venus“ – eindringlich und mit globalem Blickwinkel schildert Smith hier, wie zunehmend Bereiche der Erde von einer expansionistischen außerirdischen Spezies kolonisiert werden, und nimmt dabei das Konzept des Terraforming vorweg. Bereits in der Zukunft spielt „Die Dimension des Zufalls“, nur um die Piloten eines dortigen Weltkrieges dann auch noch in eine andere Dimension zu werfen, die allen Naturgesetzen Hohn spricht. Obwohl meist recht knapp und verdichtet erzählt, erhält jedes Abenteuer eine ganze Reihe erstaunlicher Einfälle.
Trotz innovativer Idee eine sagenhaft schlechte Geschichte ist dagegen „Der Allmächtige des Mars“: Smith schrieb diese nach einem Konzept, das aus einem Leserwettbewerb hervorgegangen war. Es beginnt mit der plötzlichen Landung eines außerirdischen Raumschiffs mitten in einem amerikanischen Stadion – eine Superintelligenz vom Mars hat beschlossen, eine Gruppe ausgewählter Menschen auf seinen Planeten einzuladen und mit ihrer überwältigenden Weisheit zu beglücken. Schon bald bilden sich unter den Menschen zwei Lager – die aufgeschlossenen Unterstützer des „Allmächtigen“ und die ewig kritischen Konservativen. Deren Charakterisierung fällt jedoch so zum Erbrechen plakativ, klischeehaft und übertrieben aus, dass die Geschichte darin manch Satire übertreffen dürfte. Die Figur des dogmatisch-ignoranten Professors, dessen Natur natürlich am Ende auf einen Großteil der Menschheit ausgedehnt wird, hätte glatt der establishmentfeindlichen Tirade eines Verschwörungstheoretikers entstammen können. Das Ende dann ist nicht nur genauso schwarzweiß-gemalt, sondern geradezu infantil-faschistoid wie die Apokalypse einer fiktiven Religion.
Dem entgegen steht die Titelgeschichte „Das Labyrinth des Maal Dweb“, hier auch direkt gefolgt von ihrer Fortsetzung „Das Wagnis des Maal Dweb“. Auf einem fremden Planeten herrscht der gleichnamige nahezu allmächtige Zauberer, der immer wieder junge Frauen in seine Burg ruft. Schließlich jedoch folgt ein junger Krieger seiner Geliebten in festem Entschluss, Maal Dweb zu töten – und sieht sich in dessen Heim einem Pandämonium von Wundern gegenüber. Hier noch am ehesten sind die Sprachgewalt und groteske Fantasie Smiths zu erahnen, die in manch anderen Geschichten künstlich gedrosselt wurden, womit „Maal Dweb“ zum Highlight faszinierender Unterhaltung wird. Im „Wagnis“ schließlich geht Maal Dweb selbst auf Wanderschaft und findet sich plötzlich als Verteidiger halbmenschlicher Pflanzenwesen gegen böse Reptiloiden wieder. Den beiden Geschichten geht in der Ausgabe zudem eine Einführung von Will Murray voraus, der insbesondere die Hintergründe der Werksgeschichte erläutert.
Auch sonst sind ferne Planeten für Smith keinesfalls vorwiegend Schauplatz klassischer Science-Fiction, sondern vielmehr Projektionsfläche reiner Fantasy – nirgendwo wird dies klarer als in „Sadastor“, wo in einer märchenhaften Handlung gar ein Dämon einen fremden Planeten bereist. Ebenso sprengt „Die Kette des Aforgomon“ jeden Kontext von Raum und Zeit: Der Schriftsteller John Milwarp wird tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden, anscheinend wie aus dem Nichts von glühenden Ketten verbrannt. Doch wie sich herausstellt, ist dies nur das letztendliche Ergebnis eines äonenweiten Dramas von Seelenwanderung, Liebe über den Tod hinaus und blasphemischer Magie.
Eine besondere Freude für Lovecraft-Fans stellt sicherlich „Die Rückkehr des Hexers dar“, worin prominent das Necronomicon auftaucht. Obwohl seinerseits von mehreren Magazinen abgelehnt, da viel zu schrecklich, stellt es nach heutigen Maßstäben schlichtweg eine solide, eher mittelmäßig verstörende Horrorgeschichte dar. Bezüge in eine ähnliche Richtung finden sich in „Ein Trank für die Mondgöttin“, wo Archäologen die Magie des versunkenen Pazifikreiches von Mu wieder zum Leben erwecken. Fast übertrieben wurde der innovative Stil jedoch in „Genius Loci“, das trotz ausgefeilter Sprache und maximal dichter Atmosphäre inhaltlich relativ unscharf bleibt. Schlussendlich finden sich noch eine orientalische Erzählung aus Smiths Jugend („Prinz Alcouz und der Magier“), eine dramatische Abenteuergeschichte aus Afrika („Die Venus von Azombeii“) und eine bitterböse Sozialsatire („Ein Gedichtband von Burns“).
Leider vermögen nicht alle Geschichten in „Das Labyrinth des Maal Dweb“ gänzlich zu überzeugen – manche sind unspektakulär, andere trotz faszinierender Idee eher reizlos inszeniert. Auch die kolonialistisch-rassistischen Aspekte in „Die Venus von Azombeii“ und vor allem dem Rassenkrieg in „Ein Abenteuer in der Zukunft“ hinterlassen heutzutage doch einen unangenehmen Nachgeschmack. Auf der anderen Seite aber stehen bildgewaltige Visionen exotischer Phantastik, die gleichsam grotesk und faszinierend daherkommen. Auf jeden Fall bietet der Band vielfältige Einblicke in das Werk eines zu Unrecht wenig bekannten Autors, dessen imaginäre Welten kaum eine Parallele finden.
Die Kinder der Nacht (REH Horrorgeschichten 5)
![Die Kinder der Nacht: Horrorgeschichten von [Robert E. Howard]](https://m.media-amazon.com/images/I/417Ev0q9UPL.jpg) Mit „Die Kinder der Nacht“ ist 2015 der fünfte und letzte Teil der gesammelten Horror- (und anderen) Geschichten von Robert E. Howard erschienen. Erneut erwarten den Leser 400 Seiten voller Spannung und Action, mal mehr und mal weniger phantastisch.
Mit „Die Kinder der Nacht“ ist 2015 der fünfte und letzte Teil der gesammelten Horror- (und anderen) Geschichten von Robert E. Howard erschienen. Erneut erwarten den Leser 400 Seiten voller Spannung und Action, mal mehr und mal weniger phantastisch.
Die Titelgeschichte führt Howards schon oft aufgegriffenes Thema der monströsen Rasse aus Britanniens Vorgeschichte weiter aus und kombiniert es abermals mit seinem ebenfalls gern genutzten Motiv der Seelenreise zu früheren Leben des Protagonisten – hier mit einem ungewohnt bedrohlichen Ende in der Jetztzeit. Besonders ausgeführt wird darum herum die zeitgenössische, heute befremdlich anmutende Rassentheorie, die doch einen gewissen (pseudo)intellektuellen Unterbau des Themas liefert.
Auch andere Geschichten sind deutlich dem Horror verhaftet: „Der schwarze Stein“ ist einerseits eine von Howards drastischsten Geschichten hinsichtlich Gewalt und Sexualität, evoziert darüber hinaus jedoch eine viel weiter gehende Atmosphäre uralten Grauens rund um die Expedition zu einem uralten Monolithen in den Bergen Ungarns. „Das Haus zwischen den Eichen“, gemeinsam mit August Derleth verfasst, weist gewisse Bezüge dazu auf, doch verortet das Grauen nunmehr unsichtbar in einem alten Haus – weniger blutig, doch nicht weniger bedrohlich. Beides sind intelligent inszenierte Geschichten mit einer Tiefe an Hintergründen, die stark (und sicher kaum zufällig) an den Stil H. P. Lovecrafts erinnern. Eine sehr kurze Werwolf-Geschichte folgt schließlich noch mit „Im Wald von Villefère“.
Deutlich verschieden und allzu individuell sind zwei andere Geschichten: „For the Love of Barbara Allen“ spielt vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs erneut mit dem Seelenreisen-Thema, hier allzu emotional bedrückend. Dagegen sprengt „Die Bewohner der Schwarzen Küste“ jede Konvention, wenn ein Paar nach einem Flugzeugabsturz auf einer rätselhaften Insel landet und sich dort einer unerwarteten Gefahr gegenübersieht – doch weder Held noch Monster sind schließlich das, was man von ihnen erwarten würde.
Eine dritte Seelenreise in die Vorzeit (dieses Motiv kommt wirklich oft vor …) gibt es in „Garten der Furcht“, wenn ein gewisser James Allison alias Steinzeit-Ase Hunwulf in einer wilden Mischung aus Eiszeit, Neolithikum und Fantasy auf den letzten Vertreter einer vormenschlichen Rasse trifft. Auch „Die Götter von Bal Sagoth“ mag einem nach Lektüre der anderen Howard-Bände etwas vertraut vorkommen, werden doch auch hier wieder beliebte Tropen recycelt: Der frühmittelalterliche Ire Turlogh O’Brien landet zusammen mit seinem Feind, dem Sachsen Athelstane, auf einer fremden Insel, wo eine Wikingerprinzessin ihre Herrschaft über ein grausam-exotisches Eingeborenenvolk zu bewahren versucht – Eskalationen mit Schwert und Axt vorprogrammiert.
Die übrigen Geschichten ähneln sich mit einer Ausnahme allesamt insofern, dass sie – wie typisch bei Howard – zähe Heldenfiguren verschiedener Zeitepochen bösen, kriminellen Fremdlingen gegenüberstellen. In „Schwarzes Canaan“ sind es die Schwarzen im Amerika des 19. Jahrhunderts, die in den Sümpfen eine Rebellion planen, in „Herr der Toten“ Mongolen und andere Asiaten inmitten der urbanen Szene des organisierten Verbrechens und in „Der Schatz des Tartaren“ ein ganzes Inventar bedrohlicher Orientalen. „Namen im schwarzen Buch“ führt die Geschichte von „Herr der Toten“ weiter, auch wenn in der Reihenfolge des Buches eine weitere Geschichte dazwischen liegt – dies ist wohl die Verschnaufpause, die der Bösewicht brauchte, um sich von seinem doch nicht tödlichen Schädeltrauma zu erholen. Gewissermaßen lesen sich diese Stories wie eine repräsentative Zusammenstellung rassistisch-exotistischer Stereotype – bis hin zu den Jesiden („Der Messingpfau“), die in guter Tradition als gewalttätige Satansanbeter charakterisiert werden. Immerhin werden die Helden manchmal von zutiefst orientalisch-traditionellen, aber wenigstens kampfstarken Mitstreitern mit scharfen Klingen unterstützt. Innovativ ist wohl keine der Geschichten, doch immerhin unterhaltsam.
An letzter Stelle schließlich steht das wieder grandiose Historien-Epos „Der graue Gott vergeht“ über die Schlacht von Clontarf im Jahr 1014. Das Aufeinandertreffen des irischen Hochkönigs Brian Boru mit der Koalition der Truppen von Leinster und skandinavischen Heerführern stilisiert Howard mit respektabler historischer Sachkenntnis zum schicksalsträchtigen Sieg Irlands über die heidnische Kultur der Wikinger.
Letztlich illustriert „Die Kinder der Nacht“ mehr noch als die anderen Bände das Hoch und Tief von Robert E. Howards Lebenswerk: Neben intelligenten Horror- und Historiengeschichten mit gut recherchierten oder konstruierten Hintergründen, die auch einmal ungewöhnliche Ideen verarbeiten, stehen Pulp-Stories mit wiederkehrendem Handlungsschema aus Exotismus/Xenophobie, grimmigen Helden und sehr viel Action, die allesamt unterhaltsam, aber doch relativ schlicht und auf Dauer ermüdend sind. Auf der einen Seite werden bestimmte Motive sehr auffällig immer wieder verwendet, auf der anderen sorgen diverse Bezüge und Anspielungen zwischen den Geschichten für den Eindruck eines gemeinsamen Universums über Zeitalter und Genres hinweg. Vielleicht nicht der beste Band der Reihe, aber gerade für die Horrorgeschichten lohnt sich die Lektüre dennoch.
Die unter den Gräbern hausen (REH Horrorgeschichten 4)
 „Die unter den Gräbern hausen“ ist der vierte Band der Horrorgeschichten-Ausgabe von Robert E. Howard im Festa-Verlag. Auch hier begegnet uns auf knapp über 400 Seiten wieder eine schillernde Mischung düsterer Schauergeschichten und historisch-phantastischer Heldenerzählungen voller Action und Schrecken.
„Die unter den Gräbern hausen“ ist der vierte Band der Horrorgeschichten-Ausgabe von Robert E. Howard im Festa-Verlag. Auch hier begegnet uns auf knapp über 400 Seiten wieder eine schillernde Mischung düsterer Schauergeschichten und historisch-phantastischer Heldenerzählungen voller Action und Schrecken.
Besonders stark vertreten sind in diesem Band die Abenteuer um den grimmigen Puritaner Solomon Kane, der Abenteuer im frühkolonialen Afrika erlebt. In „Blutige Schatten“, der ersten je veröffentlichten Solomon-Kane-Geschichte, jagt dieser etwa einen Räuberhäuptling über zwei Kontinente, wobei er auch zum ersten Mal auf den rätselhaften Zauberer N’Longa trifft.
Bei vier der Geschichten handelt es sich um unvollendete Fragmente, die Howard zu Lebzeiten nicht mehr fertigstellen konnte (oder wollte). Naheliegenderweise ist es ein wenig frustrierend, wenn jeweils die Handlung plötzlich abbricht und das Ende fehlt, doch in einer vollständigen Ausgabe dürfen natürlich auch diese nicht fehlen. In den Bänden 2 bis 4 der gesammelten Horrorgeschichten („Tote erinnern sich“, Der schwarze Hund des Todes und „Die unter den Gräbern hausen“) ist somit der gesamte Solomon-Kane-Zyklus enthalten.
Zumindest die Geschichten und Fragmente in dieser Sammlung folgen alle einem ähnlichen Schema, wenn Kane sich wieder und wieder barbarischer afrikanischer Stämme erwehren muss, die bei Howard offenbar wenig anderes zu tun haben, als Leute zu Ehren grausamer alter Götter niederzumetzeln. Dies jedoch nur, wenn sie nicht gerade von einer alten, unbekannten Hochkultur im Herzen des Schwarzen Kontinents unterdrückt werden – eine vergessene Kolonie von Atlantis in „Der Schädelmond“ oder eine vergessene assyrische Kolonie in „Die Kinder Asshurs“. Wobei die Atlanter und Assyrer natürlich finsteren alten Göttern samt Menschenopfern ebenfalls nicht abgeneigt sind, was sich wohl von selbst versteht. Man ahnt es: Die Solomon-Kane-Geschichten in diesem Buch zählen nicht wirklich zu Howards innovativsten Geschichten, was den Band gegenüber den anderen der Reihe etwas abfallen lässt. Immerhin in „Die Burg des Teufels“ legt sich Kane mit einem europäischen Adligen an – zu schade nur, dass das Fragment abbricht, bevor er die titelgebende Burg erreicht.
Die anderen Erzählungen dagegen sind vielseitiger: Moderne Horrorgeschichten sind mit der Titelgeschichte, „Der Nasenlose“ und „Der Dämon des Ringes“ vertreten. In „Die unter den Gräbern hausen“ wird ein Mann scheinbar von seinem verstorbenen Bruder heimgesucht und will sich mit zwei Bekannten endgültig dessen Todes versichern – mit fatalem Ausgang. Die Geschichte verarbeitet erneut das bereits mehrfach aus Volk der Finsternis bekannte Motiv einer uralten, unterirdischen Menschenrasse, hier zweifellos besonders wirksam inszeniert. Etwas unglücklich geraten ist wiederum „Der Nasenlose“: Bei dieser Geschichte um eine rätselhafte ägyptische Mumie wird die Pointe leider schon viel zu früh allzu offensichtlich angedeutet, wodurch der Spannungsbogen einiges an Intensität verliert. „Der Dämon des Ringes“ schließlich ist ein solider, kurzer Mystery-Thriller um einen Mann, dessen eigentlich liebende Ehefrau ihn mehrfach umzubringen versucht. In „Der Geist von Tom Molyneaux“ geht es um den harten Boxkampf zweier ungeschlagener Champions (mit natürlich ungewöhnlichem Ausgang) – von dem langjährigen Boxfan und Amateurboxer Robert E. Howard brillant atmosphärisch in Szene gesetzt.
Ein besonderes Highlight ist „Das Haus von Arabu“, das uns ins antike Sumer entführt, wo der reisende Held Pyrrhas sich zwischen der Vielzahl altorientalischer Götter, Dämonen und Intrigen bewähren muss. Obgleich der Handlungsbogen doch typische Motive verarbeitet und es eine Reihe kleinerer Unschärfen gibt, so beweist Howard doch hier eine beeindruckende Vertrautheit auch mit der Welt des antiken Mesopotamien (im Rahmen des zeitgenössischen Forschungsstandes), die er atmosphärisch und für eine Pulp-Geschichte recht authentisch zum Leben erweckt. Zwei weitere historische Erzählungen runden den Band ab: „Würmer der Erde“ wie auch „Der dunkle Mann“ spielen im antiken bzw. frühmittelalterlichen Britannien rund um die Heldentaten des ikonischen Piktenkönigs Bran Mak Morn und des wilden Gälen Turlogh O’Brien einige Jahrhunderte später – bekanntermaßen ein beliebtes Setting in den Geschichten Howards. Beide sind sie typische howard’sche Barbarenhelden, wie sie in dessen Werken alle Zeitalter bevölkern: Übermenschlich stark und zäh, ehrenhaft und zugleich rachsüchtig bis zum Blutrausch, dabei letztendlich immer latent depressiv.
Daran schließt folgerichtig der letzte Beitrag an: In einem umfangreichen Essay analisiert Don Herron Howards Barbarengestalten in Hinblick auf Vorbilder, Charakteristika und vor allem das Erbe, das sie als neuer Archetyp in der phantastischen Literatur antreten sollten. Ein Schwerpunkt liegt natürlich unweigerlich auf dem durch Marvel-Comics und Schwarzenegger-Verfilmungen zu Berühmtheit gelangten Conan, von dem freilich keine Geschichte im vorliegenden Band vertreten ist, doch treffen all diese Merkmale ganz genauso auf seine Geistesgefährten Bran Mak Morn, Turlogh O’Brien, Pyrrhas und andere zu – von Howards „Barbaren in tausend Gestalten“ könnte man in Anlehnung an Joseph Campbells Heldentypologie fast sprechen.
Im Gesamturteil fällt „Die unter den Gräbern hausen“ gegenüber den vorigen Bänden etwas ab, was vor allem an den allzu schematischen (und nach heutigen Standards ziemlich rassistischen) Solomon-Kane-Geschichten liegt. Denen stehen mit der gut durchdachten Titelgeschichte und der atemlosen Box-Geschichte „Der Geist von Tom Molyneaux“ allerdings auch einige Perlen gegenüber, begleitet durch zwar typische, aber spannend-atmosphärische Historien-Action wie das Babylonien-Abenteuer „Das Haus von Arabu“ und das wikingerzeitliche Barbarenepos „Der dunkle Mann“. Doch ob nun intelligenter Horror oder Pulp-Geschichten mit Handlung nach Baukastenprinzip – flüssig zu lesen sind sie doch alle und machen das Buch letztendlich zu einem unterhaltsamen Lesespaß.
Volk der Finsternis (REH Horrorgeschichten 1)
 Robert E. Howard (1906-1936) wird vor allem wahrgenommen als Autor von Low Fantasy- und Abenteuergeschichten, unter denen Conan der Barbar seine mit Abstand prominenteste Schöpfung ist. Weniger bekannt sind seine zahlreichen Erzählungen aus dem Bereich des Horrors und der Dark Fantasy, von denen einige dem von seinem Zeitgenossen und Bekannten H. P. Lovecraft begründeten Cthulhu-Mythos zuzuordnen sind. In einer fünfbändigen Ausgabe veröffentlichte der Festa-Verlag erstmalig über 70 dieser Kurzgeschichten und Fragmente in deutscher Sprache – den Anfang macht der Band „Volk der Finsternis“.
Robert E. Howard (1906-1936) wird vor allem wahrgenommen als Autor von Low Fantasy- und Abenteuergeschichten, unter denen Conan der Barbar seine mit Abstand prominenteste Schöpfung ist. Weniger bekannt sind seine zahlreichen Erzählungen aus dem Bereich des Horrors und der Dark Fantasy, von denen einige dem von seinem Zeitgenossen und Bekannten H. P. Lovecraft begründeten Cthulhu-Mythos zuzuordnen sind. In einer fünfbändigen Ausgabe veröffentlichte der Festa-Verlag erstmalig über 70 dieser Kurzgeschichten und Fragmente in deutscher Sprache – den Anfang macht der Band „Volk der Finsternis“.
Insgesamt 16 Geschichten auf 352 Seiten entführen uns in verschiedenste Welten: Von Howards zeitgenössischen Texas des frühen 20. Jahrhunderts bis ins exotische Afrika der Kolonialzeit, von einer düsteren amerikanischen Fischerstadt bis in die arabische Wüste, China und sogar das ferne Paläolithikum. Überall lauert das Grauen in verschiedenster Form: Schreckliche Kulte und Götzen aus uralter Zeit, vergessene Völker, Untote und Gestaltwandler. Mehr noch als in den anderen Bänden der Reihe finden sich in „Volk der Finsternis“ Geschichten aus dem Umfeld des Cthulhu-Mythos (u.a. „Schaufelt mir kein Grab“, „Die Kreatur mit den Hufen“, „Der schwarze Bär schlägt zu“) – doch bleiben die Bezüge bis auf knappe Erwähnungen der Großen Alten oder des auch von Lovecraft adaptierten Buch „Unaussprechliche Kulte“ eher oberflächlich.
Mitunter wird der trotz seiner kurzen Lebenszeit erstaunlich produktive Howard als bloßer Schreiber stumpfsinniger „Schundliteratur“ angesehen – eine Bewertung, die so pauschal abzulehnen, aber hinsichtlich mancher Aspekte auch nicht gänzlich aus der Luft gegriffen ist. Besonders auffällig sind hier die Erzählungen „Die Traumschlange“ und „Die Kobra aus dem Traum“, die letztlich beide dasselbe Thema mit demselben Ergebnis verarbeiten. Auch sonst fällt gerade bei diesem ersten Band der gesammelten Werke auf, dass viele Geschichten relativ ähnlichen Mustern mit sich wiederholenden Stereotypen folgen: Howards Protagonisten sind oft überzeichnet kernige Kämpfergestalten, die mit unglaublicher Zähigkeit den Kampf gegen Ungeheuer und Barbarenvölker aufnehmen. Kampf und Gemetzel werden zur eigenen Ästhetik erhoben, Action kommt bei Howard nie zu kurz. Anders als etwa ein Lovecraft verwendet Howard keine übermäßig hochgestochene Sprache. Seine brillante Sprachbeherrschung erweist sich nicht in detaillierten Beschreibungen und intellektuellem Ausdruck, sondern vielmehr in der dramaturgisch vollendeten Anwendung verhältnismäßig schlichter Sprache: Selbst in der modernen Fantasy erreichen wenige Autoren ein solches Maß an Dynamik, dass der Leser so in das Geschehen hineingezogen und buchstäblich hindurchgejagt wird wie bei Robert E. Howard (Stephen King: „eine so unglaubliche Energie, dass geradezu Funken sprühen“). Auch diese Aneinanderreihung von Kurzgeschichten ließt sich so flüssig wie ein guter Roman weg, der Unterhaltungswert ist erstklassig – Respekt gebührt hierbei nicht zuletzt der deutschen Übersetzung durch Doris Hummel.
Unangenehm befremdlich muten heutzutage jene Abenteuergeschichten vor allem im kolonialen Afrika an, in denen die einheimischen Schwarzen nur allzu gerne als barbarische Anhänger uralter Kulte und Schrecken erscheinen („Wolfsgesicht“, „Die Hyäne“, „Der Mond von Zambebwei“). Was heute offen rassistisch erscheint, ging in den 20er Jahren wahrscheinlich noch als normaler Exotismus phantastischer Geschichten durch. Und auch wenn Rasse und ihr Phänotyp ein immer wieder betontes Motiv sind, so erreicht Howard doch immerhin nicht die unverhohlene Menschenverachtung seines Genossen Lovecraft. Ein ähnliches Motiv, das in mehreren Geschichten aufgegriffen wird, ist die Vorgeschichte Großbritanniens, vorgestellt als Abfolge von Eroberungen verschiedener Völker – wobei ein uraltes, nicht mehr ganz menschliches Volk zur Grundlage für die Zwerge, Elfen und anderen Wesen des Volksglaubens wurde und unterirdisch in schrecklich degenerierter Form überlebt hat („Volk der Finsternis“, „Das kleine Volk“). Hinter diesem wiederkehrenden Motiv steckt bei Howard mehr als ein bloßer Fantasy-Topos, wie gerade diese Ausgabe herauszustellen weiß: Drei im Anhang abgedruckte Briefe zwischen Howard, Lovecraft und ihrem Verleger Farnsworth Wright zeugen von den den komplexen ethnologischen Überlegungen, die Howards Darstellungen zugrunde lagen. Auf Basis damaliger linguistischer und archäologischer Theorien entwickelte Howard eigene Modelle zur ethnischen Vorgeschichte Britanniens, die er in seinen Geschichten verarbeitete und auch mit Lovecraft lebhaft diskutierte. Mögen diese Ansätze im Rahmen der heutigen Forschung größtenteils obsolet geworden sein, so sind sie doch auf faszinierende Weise Zeitdokument der Gelehrsamkeit jener Zeit vor fast einhundert Jahren, für die Howard ein bemerkenswertes Maß historischer Kenntnisse in seine Texte integrierte. Dieser Mentalitätswandel der Forschung ist wohl noch bezeichnender in „Speer und Reißzähne“, Howards erster im Alter von 18 Jahren an die Zeitschrift Weird Tales verkaufter Geschichte: Geschildert wird der Konflikt zwischen Cro-Magnon-Menschen und Neandertalern in der Steinzeit – erstere etwas und letztere extrem barbarisch dargestellt, wie es Anfang des 20. Jahrhunderts noch weithin den etablierten Klischees entsprach. Überhaupt sind geschichtliche Bezüge, verhältnismäßig gut recherchiert, typisch für Howards Werk, zu dem schließlich auch ganze Zyklen historischer Erzählungen gehören (auf Deutsch u.a. in den Sammelbänden „Die Schwertkämpferin“ und „Der Löwe von Tiberias“ erschienen). Gerne lässt er dabei auch mehrere Zeitebenen sich überschneiden – in „Das Feuer von Asshurbanipal“ etwa, wo Schatzsucher eine alte assyrische Ruinenstadt in der arabischen Wüste aufsuchen, oder in „Volk der Finsternis“ selbst, da in Form einer Vision Ereignisse in der Gegenwart mit solchen in der fernen britischen Vorgeschichte parallelisiert werden.
Das Werk von Robert E. Howard lädt auf vielerlei Weise zur Erörterung ein: Hinsichtlich der verarbeiteten historischen Stoffe und ihrer Forschungsgeschichte im frühen 20. Jahrhundert ebenso wie im Kontext der zeitgenössischen Phantastik aus dem Umkreis von Weird Tales, gleichsam vor dem Hintergrund der Person und Biographie Howards wie seiner literarischen Bekanntschaften und Vorbilder. Bei aller Analyse aber sind die phantastischen Geschichten doch zuallererst großartige Unterhaltung, die so lebendig wie das Werk kaum eines anderen in exotische Zeiten und Länder voller finsterer Bedrohungen entführt.
Mehrere Geschichten aus „Volk der Finsternis“ sind übrigens auch in dem jüngst erschienenen Band „Der Mythos des Cthulhu“ enthalten. Dieser versammelt als Paperback (im Gegensatz zu den teuren Hardcovern der fünfbändigen Reihe) auf rund 500 Seiten sämtliche Cthulhu-Mythos-Geschichten Howards, die verteilt auch in den gesammelten Horrorgeschichten enthalten sind.
The Handyman
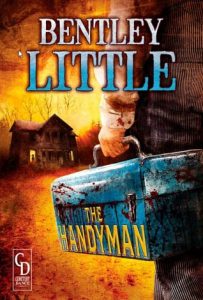 Bentley Little ist einer der „Stammautoren“ des jungen Buchheim-Verlags – also auch kein Wunder, dass mit „The Handyman“ ein Werk von ihm als 6. Band der limitierten Cemetery Dance Germany-Reihe erschienen ist. Auf rund 400 Seiten inszeniert Little eine innovative Neuinterpretation des altbekannten Geisterhaus-Themas rund um den vielleicht schrecklichsten Handwerker der Schauerliteratur …
Bentley Little ist einer der „Stammautoren“ des jungen Buchheim-Verlags – also auch kein Wunder, dass mit „The Handyman“ ein Werk von ihm als 6. Band der limitierten Cemetery Dance Germany-Reihe erschienen ist. Auf rund 400 Seiten inszeniert Little eine innovative Neuinterpretation des altbekannten Geisterhaus-Themas rund um den vielleicht schrecklichsten Handwerker der Schauerliteratur …
Die Kindheit von Daniel verlief ruhig und unspektakulär – bis seine Eltern auf die folgenschwere Idee kommen, ein Ferienhaus für die Familie zu erwerben. Der Nachbar und allzu von sich selbst überzeugte Bastler Frank Watkins bietet an, das Fertighaus für sie aufzubauen. Doch Frank ist seltsam – sein Auftreten wirkt künstlich, allem Anschein nach hat er auch Teile des Baumaterials veruntreut. Schließlich häufen sich seltsame Vorkommnisse: Schatten gehen im Haus umher. Daniel hat Albträume von Franks alter Frau Irene. Und schließlich findet man gar einen Haufen toter Hunde in dem Hohlraum unter dem Haus. Als dann auch noch Daniels kleiner Bruder bei einem Unfall ums Leben kommt, ist Frank längst über alle Berge und unauffindbar.
Jahrzehnte später – Daniel ist inzwischen ein etablierter Makler, die traumatischen Ereignisse und das Zerbrechen seiner Familie fast verdrängt. Dann aber stößt er wie durch Zufall auf eine junge Familie, deren Geschichte der seinen erstaunlich ähnelt. Das Ferienhaus seiner Eltern war nicht das einzige – wie sich herausstellt, hat Frank noch viel mehr Häuser gebaut, seine teuflische Saat über Jahrzehnte in den ganzen Vereinigten Staaten ausgebracht. Überall häuften sich rätselhafte Ereignisse, Katastrophen jeder Art und tragische Unfälle. Schon bald schlagen Daniels Recherchen in Obsession um – während sich ihm das Ausmaß des Grauens mehr und mehr offenbart, beschließt er, Frank zu finden und Rache zu nehmen …
„The Handyman“ ist kein bloßer Geisterhausgrusel. Vielmehr ist Bentley Little ein hervorragend atmosphärischer Horrorroman gelungen, in dem sich Erschreckendes, Unbekanntes und schaurige Ahnungen perfekt ergänzen. Obgleich bisweilen drastisch, sind explizite Gräuel doch nicht der Kern der Handlung. Immer weiter wird man hineingezogen in die Suche nach Frank, der überall unter anderem Namen auftaucht, eine Spur tragischer Schicksale hinter sich herzieht und anscheinend nie gealtert ist … Gerade die Ausweitung auf eine ganze Reihe von Häusern und Schicksalen macht die Geschichte besonders wirkungsvoll: Wie Kurzgeschichten werden im Mittelteil weitere Episoden eingebettet, Puzzlesteine in einem Mosaik des Grauens um den teuflischen Häuserbauer Frank. Lebendig geschilderte Einzelschicksale werden so auf eine noch weitere Ebene abstrahiert, die schließlich zunehmend kosmische Dimensionen annimmt. Für diese Brillanz des Spannungsaufbaus ist das Ende schließlich fast schon unangenehm unspektakulär, wo man vielleicht ein dramatischeres Finale erwartet hätte. Doch das tut der Gesamtqualität des Werkes keinen Abbruch – leicht und flüssig geschrieben, noch dazu atmosphärisch illustriert von Glenn Chadbourne, bleibt „The Handyman“ ein hervorragender Schauerroman, der auf einzigartige Weise lebendige Schicksale und wirkungsvollen Kontext, klassischen Gothic Horror und harten Thriller miteinander vereint.
Absorption
![Absorption von [Ian Cushing]](https://m.media-amazon.com/images/I/51lT5HfMOkL._SY346_.jpg) Mit „Absorption“ ist vor kurzem das dritte Buch von Ian Cushing (In Ewigkeit, Die Träne der Zauberschen) erschienen – nach einer Novelle und einem Roman handelt es sich nun um die erste Kurzgeschichtensammlung des engagierten Neuautors. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – im Self-Publishing veröffentlicht, ist es dem Autor bereits gelungen, eine Art eigene Marke zu etablieren. Das atmosphärische Cover stammt wie bei den vorigen Bänden von dem Künstler Karmazid, diesmal jedoch ergänzt durch zahlreiche weitere Illustrationen am Anfang eines jeden Kapitels. Das dient nicht nur dem Wiedererkennungswert, sondern verleiht dem Werk auch schon eine allein optische Qualität, die mühelos mit Verlagspublikationen mithalten kann und einen unverwechselbaren eigenen Akzent setzt.
Mit „Absorption“ ist vor kurzem das dritte Buch von Ian Cushing (In Ewigkeit, Die Träne der Zauberschen) erschienen – nach einer Novelle und einem Roman handelt es sich nun um die erste Kurzgeschichtensammlung des engagierten Neuautors. Obwohl – oder vielleicht gerade weil – im Self-Publishing veröffentlicht, ist es dem Autor bereits gelungen, eine Art eigene Marke zu etablieren. Das atmosphärische Cover stammt wie bei den vorigen Bänden von dem Künstler Karmazid, diesmal jedoch ergänzt durch zahlreiche weitere Illustrationen am Anfang eines jeden Kapitels. Das dient nicht nur dem Wiedererkennungswert, sondern verleiht dem Werk auch schon eine allein optische Qualität, die mühelos mit Verlagspublikationen mithalten kann und einen unverwechselbaren eigenen Akzent setzt.
12 Geschichten und ein Gedicht sind hier auf rund 250 Seiten versammelt – in Genre und Thema grundverschieden und doch verwandt im charakteristischen Stil des Autors.
Ein Mann sieht sich an Weihnachten hilflos einer „Home Invasion“ gegenüber, ein König muss sich mit seltsam archetypischen Beratern herumschlagen und eine an überhaupt kein reales Vorbild erinnernde Politikerin wird plötzlich mit der Realität konfrontiert …
Klassische Horrorfilmfiguren verbringen ihr allzu unspektakuläres (Un-)Leben in einer Seniorenresidenz, der gemeinsame Tod eines unglücklichen Liebespaares bringt nicht das gewünschte Ergebnis und auch ein erfolgreicher Topagent ist nicht ganz das, wofür er sich hält …
Am längsten schließlich ist die letzte Geschichte „Der Spuk“ – ein drastischer Psychothriller über eine labile Frau, die seltsame Geräusche im Haus vernimmt und doch nicht annähernd das Ausmaß der menschlichen Abgründe um sich herum erahnt …
Cushings Werke sind nur allzu persönlich, in diesem Falle noch verstärkt durch ein kurzes Nachwort zu den Hintergründen einer jeden Kurzgeschichte. Gewichtige Themen wie Tod, Liebe und Demenz reizen Cushing zu manch philosophischen Szenarien, die gerade in ihren subjektiven Ansätzen die ganze Skala von kitschig bis zynisch ausreizen. Möglich wir das nur durch eine trotz unweigerlicher Kürze meisterhaft lebendige Charakterzeichnung, beim introvertierten Musikliebhaber ebenso wie beim alten Ehepaar und eiskalten Psychopathen. Rund um die in mehreren Geschichten auftretende Ortschaft Pfuhlenbeck zeichnet sich mittlerweile ein ganzes Universum mit wiederkehrendem Figureninventar ab: In gleich zwei Geschichten begegnen wir Hank, einem schamlos herumphilosophierenden Trinker, der seinen dritten Auftritt übrigens in einem Beitrag der Anthologie „Zombie Zone Germany“ hat. Und auch die teils toten, teils lebendigen Protagonisten aus „Die Träne der Zauberschen“ erleben manch unerwarteten neuen Auftritt. Man kann gespannt sein, wie sich dieser Kosmos im Zukunft entwickeln mag …
Von Phantastik und Drama bis zum Märchen – „Absorption“ bedient ganz verschiedene Genres und lässt sich doch im Ganzen unmöglich einordnen. Innovativ aber sind alle Geschichten – so unterschiedlich auch ihre jeweilige Aussage, wird doch eine jede pointiert und plastisch zum Leben erweckt. Durchaus von einiger literarischer Qualität, liest sich das Buch doch aller Bedeutungslast zum Trotze kurzweilig und unterhaltsam – eine lohnende Lektüre also, die buchstäblich zur Absorption einlädt.
Anmerkung: Persönliches Rezensionsexemplar – könnte Spuren von Befangenheit enthalten.
Tortured Souls / Infernal Parade
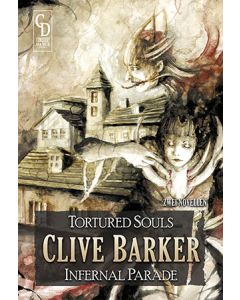 Es kommt wohl der Erfüllung eines Herzenswunsches vieler Horror-Leser gleich, was jüngst der Buchheim-Verlag als fünften Teil von Cemetery Dance Germany veröffentlichte: Den illustrierten und signierten Doppelband der Novellen „Tortured Souls“ und „Infernal Parade“ von Horror-Legende Clive Barker. Wenngleich ziemlich kurz und schnell gelesen, ist das Buch doch eine typische Perle des bekannten Barker-Stils, dem schon Klassiker wie die „Bücher des Blutes“ und die Geschichte des bekannten Splatterfilms „Hellraiser“ entsprangen.
Es kommt wohl der Erfüllung eines Herzenswunsches vieler Horror-Leser gleich, was jüngst der Buchheim-Verlag als fünften Teil von Cemetery Dance Germany veröffentlichte: Den illustrierten und signierten Doppelband der Novellen „Tortured Souls“ und „Infernal Parade“ von Horror-Legende Clive Barker. Wenngleich ziemlich kurz und schnell gelesen, ist das Buch doch eine typische Perle des bekannten Barker-Stils, dem schon Klassiker wie die „Bücher des Blutes“ und die Geschichte des bekannten Splatterfilms „Hellraiser“ entsprangen.
„Tortured Souls“ spielt in der fiktiven und irgendwie völlig zeitlosen Stadt Primordium, die selbst mehr Allegorie ist als historisch fassbar. Hier lebt der verbitterte Attentäter Zarles Kreiger, den die Begegnung mit der Tochter seines letzten Opfers endgültig desillusioniert. Um sich gegen die dekadente Herrschaft des Imperators von Primordium aufzulehnen, sucht er die Hilfe von Agonistes – einem uralten Wesen jenseits von Gut und Böse, das die Verzweifelten in grausiger Manier zu furchtbaren Schrecken ihrer Mitmenschen umgestaltet. Kreiger und seine Geliebte Lucidique sehen sich einer Welt aus Blut und Elend gegenüber …
Einerseits evoziert die Geschichte allzu verstörende Schrecken blasphemischer Verwandlungen, wie wir es aus Hellraiser & Co. kennen, doch all das fast ohne konkrete, plastische Details. Während Barker das Lesergehirn anregt, sich diese Gräuel schön selbst noch lebendiger auszumalen, als es seine Worte vielleicht könnten, widmet er jene lieber den charakterlichen Verwicklungen, den schon ans Märchenhafte grenzenden Intrigen von Primordium und einer Auswahl weiterer grotesker Schrecken. „Tortured Souls“ liegt den bekannten Themen im Werk von Clive Barker naturgemäß nahe, bleibt als skurriles, wenngleich großartig inszeniertes Splatterpunk-Märchen aber doch einzigartig.
In der Handlung weit weniger stringent ist der zweite Teil „Infernal Parade“: Hier wird der zum Tode verurteilte Tom Requiem von einer düsteren Parallelgesellschaft mit dem Anführen einer Höllenparade beauftragt, deren Teilnehmer er zunächst noch einsammeln muss. So ist dann abseits dieser Rahmenhandlung die Novelle eigentlich mehr eine Aneinanderreihung von vier mehr oder weniger unabhängigen Kurzgeschichten, die doch alle für sich lebendigen Horror ganz unterschiedlicher Art heraufbeschwören. Wir haben da einen Jungen, der fahrlässig einen Golem mit der Vernichtung seiner kaputten Familie beauftragt, oder den gewissenlosen Dr. Fetter, der seine Profession im Erschaffen von Monstern gefunden hat. In einer an Primordium aus „Tortured Souls“ erinnernden Fantasiewelt entspannen sich soziale Unruhen, schließlich greift auch eine junge Frau mit ihrem so vielversprechenden Liebeszauber daneben …
Genau wie der Vorgänger ist „Infernal Parade“ ein Experiment abseits klassischer Konventionen, und dabei auch genauso wirkungsvoll. Jede einzelne Geschichte ist für sich beunruhigend und zugleich innovativ – nicht bloßer Splatter-Horror, sondern durchdachte Parabeln mit teils drastischen Horror-Elementen. Atmosphärisch passend tragen dazu auch die meist düsteren und etwas abstrahierten Illustrationen bei.
Damit ist der ganze Doppelband gleichsam repräsentativ und bemerkenswert für das Werk Clive Barkers: Selten hat es ein Autor geschafft, solch schockierende Erzählungen zugleich so intelligent und poetisch zu inszenieren. Barker beweist, dass das Splatterpunk-Genre sich nicht mit stupiden Geschichten begnügen muss, sondern zugunsten von Stil und Handlung sogar die plastischen Schrecken einmal zurückstellen kann, während sie andernorts eben ihre inhaltliche Funktion erfüllen. Von dieser Art hätte man durchaus noch einiges mehr lesen können.
Turn Down the Lights
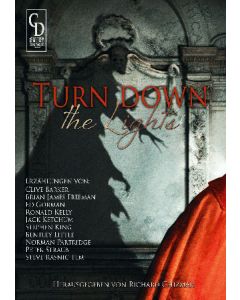 Während das Horror-Magazin Cemetery Dance in Deutschland erst seit kurzem mit einer Reihe beim Buchheim-Verlag vertreten ist, feierte es im englischen Sprachraum bereits sein 25-jähriges Jubiläum. Dazu erschien eine Anthologie voller Geschichten namhafter Horror-Autoren, die zu unserem Glück auch als vierter Band in die deutsche Reihe übernommen wurde. Mit 200 Seiten und großer Schrift ist „Turn Down the Lights“ nicht allzu umfangreich (innerhalb von ein bis zwei Tagen durchgelesen), doch dafür durch das Format sowie individuelle Illustrationen zu jeder einzelnen Geschichte umso hochwertiger gestaltet.
Während das Horror-Magazin Cemetery Dance in Deutschland erst seit kurzem mit einer Reihe beim Buchheim-Verlag vertreten ist, feierte es im englischen Sprachraum bereits sein 25-jähriges Jubiläum. Dazu erschien eine Anthologie voller Geschichten namhafter Horror-Autoren, die zu unserem Glück auch als vierter Band in die deutsche Reihe übernommen wurde. Mit 200 Seiten und großer Schrift ist „Turn Down the Lights“ nicht allzu umfangreich (innerhalb von ein bis zwei Tagen durchgelesen), doch dafür durch das Format sowie individuelle Illustrationen zu jeder einzelnen Geschichte umso hochwertiger gestaltet.
Herausgeber Richard Chizmar schreibt im Vorwort interessant über die Geschichte des CD-Magazins, Horrorautor Thomas F. Monteleone („Das Blut des Lammes“) schließt das Werk mit einem ebenso persönlichen Nachwort ab. Wie schon Band 2 „Shivers VIII“ startet auch dieses Buch mit einer gewohnt atmosphärischen Geschichte von Stephen King, deren Handlung dann aber doch eher unspektakulär ist. Die übrigen Geschichten dann decken ein breites Spektrum düsterer Szenarien ab: Jack Ketchum, eigentlich eher bekannt für realistische Psycho-Thriller, bietet mit „Die Toten des Westens“ eine zwar grausige, aber keinesfalls plastisch-actionbasierte Zombie-Geschichte aus dem Wilden Westen – mit Verbindungen ins Alte Ägypten. Schließlich gibt es drastische Monstergeschichten mit Ronald Kellys „Das Plumpsklo“ und Steve Rasnic Tems „Schräge Vögel“, Bentley Little legt mit „Im Zimmer“ eine solide, etwas beunruhigende Coming-of-Age-Mystery-Story vor. Besonders schön erscheint „Alleinflug“ von Ed Gorman – eigentlich kein Horror, sondern die lebendige Geschichte über zwei alte Männer, die angesichts des Lebensendes zu kompromisslosen Helden des Alltags mutieren. Horror-Ikone Clive Barker schreibt in „Püppchen“ über das harte Schicksal eines Mädchens – und die zunehmend bedenkliche Beziehung zu ihrer Puppe. „Die gesammelten Kurzgeschichten von Freddie Prothero, Einleitung von Dr. phil. Torless Magnussen“ von Peter Straub ist vielleicht der verstörendste Beitrag, indem er aus reichlich surrealer Perspektive die Gedanken eines Kindes zelebriert.
Leider ist „Turn Down the Lights“ so schnell durchgelesen, dass das Vergnügen nicht lange währt. Doch macht sich der prominent besetzte Horror-Prachtband nicht nur schön im Regal, sondern unterhält auch hervorragend mit seinen zehn düsteren Geschichten. Der Titel aber erfordert wohl eine gewisse Erläuterung: Während es zwar die Lesedauer verlängert, das Licht bereits vor Beendigung des Lesevorgangs zu dimmen, ist es doch dem Unterhaltungswert nur wenig zuträglich. Eine Verdunkelung in Anschluss daran ermöglicht dagegen die vorgesehene Diffusion der Eindrücke im Gehirn, die als beunruhigender Nachgeschmack eher vorgesehen ist.
The Mountain King
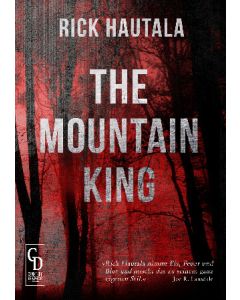 Obwohl Rick Hautala über 90 Romane und Kurzgeschichten veröffentlichte und in der Horrorliteratur des englischen Sprachraums weite Beachtung fand, ist erst nun, sechs Jahre nach seinem Tod, sein erster Roman ins Deutsche übersetzt worden: „The Mountain King“, erschienen als dritter Band der Serie „Cemetery Dance Germany“ im jungen Buchheim-Verlag. Es ist der bislang einzige längere Roman in dieser Reihe, die etwa mit Widow’s Point und Shivers VIII bislang eher Novellen und Anthologien veröffentlichte. Wie auch alle anderen Teile liegt „The Mountain King“ in großformatiger Edelausgabe vor, samt einigen schönen Illustrationen und Nummerierung.
Obwohl Rick Hautala über 90 Romane und Kurzgeschichten veröffentlichte und in der Horrorliteratur des englischen Sprachraums weite Beachtung fand, ist erst nun, sechs Jahre nach seinem Tod, sein erster Roman ins Deutsche übersetzt worden: „The Mountain King“, erschienen als dritter Band der Serie „Cemetery Dance Germany“ im jungen Buchheim-Verlag. Es ist der bislang einzige längere Roman in dieser Reihe, die etwa mit Widow’s Point und Shivers VIII bislang eher Novellen und Anthologien veröffentlichte. Wie auch alle anderen Teile liegt „The Mountain King“ in großformatiger Edelausgabe vor, samt einigen schönen Illustrationen und Nummerierung.
Mark Newman und sein Freund Phil Sawyer sind auf einer Wanderung am unwirtlichen Mount Agiochook. Dann, während eines Schneesturmes, kommt es zur Katastrophe – Phil stürzt an einer Felsklippe ab und bleibt reglos liegen. Hilflos muss Mark beobachten, wie der Freund von einem haarigen Ungeheuer gepackt und verschleppt wird. Allein kehrt er in seinen Heimatort zurück. Während die anderen Bewohner ihn zunehmend des Mordes an Phil verdächtigen, glaubt Mark als einziger noch an das Überleben seines Freundes und kann es nicht erwarten, in die Wildnis zurückzukehren. Doch die Kreatur in den Bergen hat Blut geleckt und folgt dem Geflüchteten ins Tal – schon bald müssen nicht nur Mark und seine Familie um ihr Leben fürchten …
„The Mountain King“ fesselt von Anfang an – und später umso mehr. Mehrere Perspektiven wechseln sich ab, was immer wieder die Spannung wechselseitig erhöht. Hautala ist ein Roman gelungen, der trotz phantastischer Elemente letztlich knallhart in der Realität verwurzelt bleibt. Die halbmenschlichen Ungeheuer – der Name Bigfoot fällt trotz eindeutiger Anklänge nicht – sind keinesfalls überzeichnet, vielmehr allzu naturalistisch dargestellt und damit umso bedrohlicher. Was den Umgang der anderen Menschen mit Phil angeht – Unglaube und Misstrauen – umschifft Hautala die schon zwangsläufig zu erwartenden Klischees zugunsten differenzierterer Charakterzeichnung. Drastisch sind schließlich die Gewaltszenen, weniger durch Menge und Detail als vielmehr wohl dosierte Inszenierung, wenn sich der Roman gegen Ende – nach Enttäuschung so mancher Erwartungen des Lesers – endgültig zum bloßen Überlebenskampf verdichtet.
Obwohl bisweilen recht blutig, ist „The Mountain King“ letztendlich eben keine stupide Monstergeschichte, sondern vielmehr ein schonungsloser und spannender, weil flüssig und zugleich realistisch geschriebener Horrorthriller, wirkungsvoller als ein Großteil der einschlägigen Genreliteratur. Dass von den Werken Rick Hautalas gerade dieses Eingang in die deutsche Sammler-Reihe fand, ist durchaus verständlich, auch ohne die übrigen zu kennen.

![Der Mythos des Cthulhu: Erzählungen von [Robert E. Howard]](https://m.media-amazon.com/images/I/51PQ8H4K0+L.jpg)